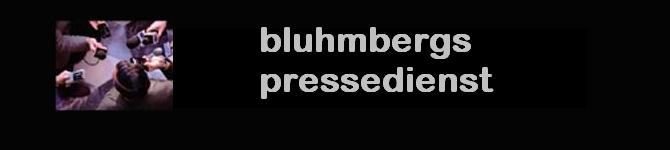Open BC plant die Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Börse für den 7. Dezember 2006. Der Angebotszeitraum soll am 4. Dezember beginnen und drei Tage dauern, zuvor werde sich das Management am 27. November auf eine Roadshow begeben. Während dieser Präsentationsphase soll die Preisspanne und der genaue Umfang des Angebots im so genannten "decoupled process" festgelegt werden.
An Investoren verkauft werden sollen bis zu 2,18 Millionen Aktien zuzüglich einer eventuellen Mehrzuteilung (Greenshoe) von bis zu 327.268 weiteren Aktien. Das Angebot umfasst maximal 1.350.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 831.781 Aktien aus dem Besitz der Altaktionäre. Den ihr zufließenden Teil des Nettoemissionserlöses sieht die Gesellschaft bei 35,6 Millionen bis 63,7 Millionen Euro.
Der Streubesitz soll nach dem Börsengang und nach Ausübung des Greenshoe mindestens 40 Prozent betragen. Bestimmten zahlenden Kunden und anderen will Open BC bis zu 19 Prozent der angebotenen Aktien für eine bevorrechtigte Zuteilung reservieren.
Vor allem natürlich - böse Zungen sagen: lediglich - die Analysten der Konsortialbanken erwarten für das Unternehmen in den kommenden Jahren hohe Wachstumsraten. So soll der Umsatz von rund 21 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2007 auf rund 56 Millionen Euro im Jahr 2009 steigen, wie die Analysten der Konsortialbanken hoffen und daher voraussagen. Im Geschäftsjahr 2005/2006 erzielte das Unternehmen noch einen Umsatz von rund sechs Millionen Euro.
Im ersten Quartal des Rumpfgeschäftsjahrs 2006/07 per Ende September erzielte Open BC mit 319.000 Euro erstmals ein Gewinn, der Umsatz lag im gleichen Zeitraum bei 2,7 Millionen Euro.
Ende September hatte Xing rund 1,45 Millionen Mitglieder, von denen nach Unternehmensangaben 13 Prozent einen monatlichen Beitrag von 5,95 Euro bezahlten. Wie Finanzvorstand Eoghan Jennings erklärte, liegt die durchschnittliche monatliche Kündigungsquote bei rund 1,5 Prozent. Die monatliche Gebühr werde auch in Zukunft einzige Einnahmenquelle des Unternehmens sein.
bluhmberg - 29. Nov, 12:19
Zwar sind Auflage und Vertrieb von Hedge-Fonds in Deutschland seit 2004 erlaubt, doch der Markt kommt nur stockend in Gang. In den gut 40 Produkten stecken gerade mal 2,5 Mrd. Euro. Einige Anbieter haben sich bereits wieder zurückgezogen. Daher wählen die meisten Anleger - sowohl professionelle als auch private Investoren - den Weg über Zertifikate, deren Verkauf auch schon vor 2004 zugelassen war. Der Grund: Die deutschen Dach-Hedge-Fonds sind aus steuerrechtlichen Gründen bei der Auswahl der Einzelprodukte, in die sie investieren, eingeschränkt. Mithilfe von Zertifikaten auf Hedge-Fonds können die Investoren und die emittierenden Banken diese Hürde umgehen. Grundsätzlich ist es international allerdings üblich, dass Aufsichtsbehörden es privaten Anlegern erschweren, Geld in Hedge-Fonds zu stecken. Die Anlageklasse ist weitgehend unreguliert, in vielen Fällen intransparent und gilt deshalb als riskant.
Doch bisher überzeugen auch die in Deutschland angebotenen Zertifikate nicht: Nach Zahlen des BAI haben die Produkte ihren Wert seit Jahresbeginn um zwei bis drei Prozent gesteigert, eine ähnlich schwache Rendite erzielten im Schnitt auch die in Deutschland aufgelegten Hedge-Fonds. "Das liegt an den Gebühren", sagt ein Branchenkenner, der selbst Hedge-Fonds-Zertifikate verkauft. In der Regel zahlen Anleger für die Strukturierung der Produkte. "Der Nachweis ist noch nicht erbracht, dass die Gebühren gerechtfertigt sind", sagt ein anderer Branchenkenner. An die wirklich guten Fonds kämen die Privatinvestoren auch über Zertifikate kaum heran. Hedge-Fonds seien ohnehin intransparent, sagt auch Werner Hedrich, Chefanalyst der Fondsratingagentur Morningstar im deutschsprachigen Raum. "Bei den Zertifikaten fehlen die Vergleichsmöglichkeiten."
"Deutschland ist ein Sonderfall", sagt Martin Keller, Global Head of Hedge Fund Investments von Deutsche Bank Private Wealth Management. "Es hat relativ wenig gute Produkte gegeben. Sie wurden zu teuer und mit übertriebenen Renditeerwartungen angeboten." Doch das ändere sich jetzt. Deutsche Investoren hätten heute bessere Auswahlmöglichkeiten. "Vor zwei Jahren hatten wir zwei Produkte, heute sind es mehr als 20", sagt Keller über das eigene Angebot.
Auch die Konkurrenz bringt verstärkt Hedge-Fonds-Zertifikate auf den Markt. Der sich abzeichnende Wettbewerb könnte die Preise für die Anleger künftig günstiger gestalten. "Der Zertifikatemarkt boomt. Private und institutionelle Anleger suchen nach Investitionen", sagt auch Klaus-Wilhelm Hornberg, als Geschäftsführer bei Oppenheim Asset Management zuständig für Dach-Hedge-Fonds. Ein Sprecher des BAI bestätigt: "Es kommen mehr Produkte."
Nicht nur Banken drängen über strukturierte Produkte nach Deutschland: Die Dortmunder Gesellschaft Apano etwa hat sich auf den Vertrieb von Hedge-Fonds spezialisiert und verkauft Zertifikate auf Produkte des weltgrößten Hedge-Fonds-Anbieters Man Group.
Zwar betonten zahlreiche Anbieter, dass Hedge-Fonds generell für alle Investoren geeignet seien. Doch Einstiegssummen liegen häufig bei 10.000 Euro, teilweise auch bei mehr als 50.000 Euro. Vereinzelt wagen Investoren inzwischen auch Anlagen in Hedge-Fonds, die zwar nicht in Deutschland aufgelegt sind, aber die Steueranforderungen erfüllen. Bei diesen Privatplatzierungen betrage die Mindestanlage meist 50.000 Euro, sagt Mathias Ranke, bei der Société-Générale-Tochter Lyxor Leiter des Geschäfts für Alternative Anlagen in Europa und Österreich. "Ohne Kapitalgarantie in Hedge-Fonds zu investieren, das ist schon ziemlich riskant und für einen Bruchteil der Anleger reserviert."
bluhmberg - 29. Nov, 12:12
Der mit einem Volumen von voraussichtlich rund 1,3 Milliarden Euro größte Börsengang des Jahres hat am Montag verhalten Fahrt aufgenommen. Der nach eigenen Angaben viertgrößte Duft- und Aromastoffhersteller Symrise will durch eine Kapitalerhöhung rund 650 Millionen Euro einnehmen. Dafür hat sich die Gesellschaft im Wertpapierprospekt die Ausgabe von bis zu 65 Millionen Aktien vorbehalten. Auch die Altgesellschafter können bis zu 65 Millionen Aktien verkaufen.
„Dies ist das theoretische Maximalvolumen, das wir aus juristischen Gründen angeben, um uns vor allen Eventualitäten zu schützen“, sagte Georg Hansel von der Deutschen Bank, die gemeinsam mit der UBS das den Börsengang begleitende Bankenkonsortium anführt. „Tatsächlich wird eine deutlich geringere Anzahl von Aktien angeboten werden.“ Deshalb sei es unzulässig, von Aktienkursen von rund 10 Euro auszugehen. Wie viele Aktien in welcher Preisspanne zur Zeichnung angeboten werden, soll erst am Ende dieser Woche feststehen. Dann sind die ersten Gespräche mit potentiellen Großinvestoren geführt worden.
Die vorsichtige Herangehensweise begründet Hansel so: „Wir wollen keine Bewertungsdiskussion auf Basis des Prospektes.“ Diese konzentriere sich schnell darauf, was das Unternehmen höchstens wert sei. „Wir halten es nicht für zielführend, sich auf das untere Ende der Spanne für den Unternehmenswert zu konzentrieren.“ Die Kapitalerhöhung werde Symrise 600 bis 700 Millionen Euro einbringen. Die Entscheidung darüber, wie viele Aktien der Großaktionär, der skandinavische Finanzinvestor EQT, von seinem Anteil von 80 Prozent abgebe, stehe aus. Nach dem Börsengang werde der Streubesitz zwischen 50 und 90 Prozent liegen, sagte Hansel nur. Damit ist Symrise ein Kandidat für den M-Dax.
Ein Grund für die Geheimniskrämerei könnte darin liegen, daß EQT nach Informationen dieser Zeitung eine Marktkapitalisierung von 3 Milliarden Euro anstrebt. Allerdings kommen nur die optimistischsten Analysten aus dem
Bankenkonsortium auf eine Eigenkapitalbewertung von etwas mehr als 3 Milliarden Euro. Die meisten, darunter der Konsortialführer UBS, sind deutlich zurückhaltender. UBS kommt in einer nichtöffentlichen Studie, die uns seit gestern in Teilen vorliegt, auf eine Marktkapitalisierung von 1,8 bis 2,4 Milliarden Euro. Dies entspreche, so schreiben die Analysten, dem 1,8- bis 2,3fachen des für 2008 wahrscheinlichen Umsatzes und des 8,5- bis 11fachen des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda).
Viele Börsenkandidaten hatten in den vergangenen Wochen ihre Preisvorstellungen nicht durchsetzen können. Finanzinvestoren, die als besonders preissensibel gelten, sagten zum Beispiel im Fall von
Wacker Construction den Börsengang ab. Im Fall von Klöckner & Co verkauften sie im Rahmen des Börsengangs weniger als geplant und holten den Aktienverkauf später nach. So könnte es auch EQT machen. Ein Sprecher von EQT wollte dies nicht kommentieren.
Die Einnahmen aus der Kapitalerhöhung will Gerold Linzbach, Vorstandsvorsitzender von Symrise, vorwiegend für den Abbau der Schuldenlast von 1,4 Milliarden Euro verwenden, die im Zusammenhang mit der Übernahme durch EQT entstanden waren. Der skandinavische
Finanzinvestor hatte 2002 Haarmann & Reimer von Bayer gekauft und mit dem Familienunternehmen Dragoco zu Symrise verschmolzen. Seither kontrolliert EQT rund 80 Prozent der im niedersächsischen Holzminden ansässigen Gesellschaft, die 4800 Mitarbeiter beschäftigt. Trotz der auch nach der Kapitalerhöhung hohen Schuldenlast will Symrise im Frühjahr eine „branchenübliche“ Dividende zahlen.
Durch den geplanten Zusammenschluß der beiden Konkurrenten Givaudan und Quest sieht Vorstandschef Linzbach Symrise nicht unter Fusionsdruck. „Um mit internationalen Konsumgüterproduzenten ins Geschäft zu kommen, liegt die kritische Größe in unserer Branche bei etwa einer Milliarde Euro Umsatz.“ Oberhalb dieser Marke spiele die Unternehmensgröße eine untergeordnete Rolle. Symrise erwirtschaftete 2005 einen Umsatz von 1,15 Milliarden Euro und sieht sich weltweit als die Nummer vier auf dem Markt der Duft- und Aromastoffe.
„Wir planen keine großen Akquisitionen“, fügte Linzbach hinzu. Symrise konzentriere sich auf kleinere Zukäufe. Sie dienten dazu, technologisches Wissen hinzuzugewinnen. In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres steigerte Symrise den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9,1 Prozent auf 865 Millionen Euro. Der operative Gewinn kletterte um 34,3 Prozent auf 192,2 Millionen Euro.
Die Erstnotiz im stark regulierten Börsensegment Prime Standard ist für den 11. Dezember geplant. Zwischen 10 und 20 Prozent der Emission könnten nach Angaben der Deutschen Bank an Privatanleger gehen.
bluhmberg - 28. Nov, 13:01
Elf Händler verkauften den Recherchen zufolge insgesamt 100 Kilo verbotener und zum Teil hochgiftiger Pestizide an die Greenpeace-Mitarbeiter, die sich als Landwirte und Agrarberater tarnten. Vier dieser elf Händler gehören zum größten Agrarhändler in Deutschland, dem Raiffeisenverband. Eine der Raiffeisen-Filialen der Zentralgesellschaft Karlsruhe in Salmbach/Elsass hat den
Greenpeace-Recherchen zufolge zehn Liter des gefährlichen "Schwiegermuttergifts" E605 verkauft, gegen Barzahlung und ohne Rechnung.
In anderen Fällen bekamen die Rechercheure sogar eine Rechnung auf das verbotene Gift ausgestellt. Bei deutschen Händlern stammte diese jedoch nicht von dem Unternehmen, bei dem eingekauft wurde, sondern von Händlern auf der französischen Seite des Grenzgebiets. Zum Teil wurde die Ware sogar bis an die Haustür geliefert. Die Geschehnisse wurden von
Greenpeace mit Dokumenten, Protokollen und Fotos belegt.
Insgesamt konnte Greenpeace in 38 Fällen illegale Spritzmittel erwerben, die elf in Deutschland nicht oder nicht mehr zugelassene Wirkstoffe enthalten. Sechs dieser Stoffe sind auch EU-weit verboten. Die meisten der erworbenen Gifte können starke Gesundheitsschäden hervorrufen: So führte die Einnahme von Parathion (E605) bereits zu Todesfällen, das Fungizid Vinclozolin ist krebserregend und schädigt die Entwicklung von Kindern. Andere Stoffe beeinträchtigen die Fortpflanzungsfähigkeit und beeinflussen das Hormonsystem.
Die verantwortlichen Behörden waren offenbar nicht daran interessiert, dem Treiben ein Ende zu bereiten. Greenpeace wandte sich an das Landwirtschaftsministerium von Baden-Württemberg, um einen der Händler auf frischer Tat zu stellen. "Das Ministerium lehnte ab und weigerte sich, Ermittlungsbehörden vor Ort zu benennen", sagt Martin Hofstetter, Agrar-Experte bei Greenpeace.
Dass die verkauften Gifte auch regelmäßig eingesetzt werden, konnte Greenpeace bereits in früheren Tests nachweisen. Vor allem in Johannes- und Stachelbeeren, aber auch in vielen Gemüsesorten fanden Mitarbeiter der Umweltschutzorganisation zahlreiche in Deutschland oder Europa verbotene Pestizide. Auch die Lebensmittelüberwachungen in Baden-Württemberg und Niedersachsen fanden 2005 in Obstproben eine ganze Reihe verbotener Gifte.
bluhmberg - 28. Nov, 12:28
Sportvereinen und Fernsehsendern in Nordrhein-Westfalen darf die Werbung im Internet für private Sportwettenanbieter wie bwin vorerst verboten werden. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) für Nordrhein-Westfalen in Münster in mehreren am Montag bekannt gegebenen Beschlüssen entschieden. In der Hauptsache ist jedoch noch nicht entschieden.
Die Richter stützten in dem Eilverfahren das zuvor von der Bezirksregierung Düsseldorf als Medienaufsicht des Landes ausgesprochene Internet-Werbeverbot für Sportvereine und Fernsehsender. Es handele sich um Werbung für unerlaubtes Glücksspiel, befanden die Richter (Az.: 13 B 1796/06 u.a.). Die Beschlüsse sind unanfechtbar.
bluhmberg - 27. Nov, 23:05
Online-Banking ist heute zur Selbstverständlichkeit geworden. Nach den Ergebnissen einer aktuellen Umfrage der Postbank führen fast drei Viertel aller Online-Nutzer ihre Bankkonten online. Dabei liegen die so genannten Silver Surfer, Senioren ab einem Alter von 60 Jahren, in der Rangliste der Online-Banker mit einem Anteil von über 83 Prozent vorn. Den zweiten Platz nehmen mit fast 78 Prozent die 40- bis 49-Jährigen ein. Dagegen liegt der Anteil in der jüngsten Altersgruppe bei nur etwa der Hälfte aller befragten Surfer.
Vor allem die Zeitersparnis ist für die Senioren ein wichtiges Kriterium beim Online-Banking. Weitere Aspekte sind die bessere Kontokontrolle, die jederzeit und aktuell am Computer erfolgen kann, die Unabhängigkeit vom Filialnetz, die immerhin fast drei Viertel der Befragten angeben und die geringeren Kosten.
bluhmberg - 27. Nov, 22:37
Der österreichische Discount Broker direktanlage.at steuert zum fünften Mal in Folge auf ein Rekordjahr zu. Ende 2006 wird das Kunden-Portfoliovolumen erstmals die Zwei-Milliarden-Euro-Grenze überschreiten, auch die Anzahl der Kunden steigt kontinuierlich. Nahezu täglich gewinnt die Bank einen Anleger mit über 250.000 Euro dazu.
Vorstandsvorsitzender Ernst Huber prognostiziert in allen wichtigen Bereichen steigende Zahlen: "Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - EGT - wird gegenüber den fünf Millionen Euro im Jahr 2005 heuer wohl erneut um deutlich über 50 Prozent wachsen. Besonders stolz sind wir auch auf das stetige Wachstum unserer Kundenanzahl, diese wird heuer von 36.000 im Vorjahr auf rund 42.000 steigen. Das Kundenportfoliovolumen wächst voraussichtlich um 500 Mio. auf mehr als 2,2 Milliarden Euro."
Besonders auffällig ist die rasant wachsende Zahl der Neukunden mit besonders hohem Anlagevolumen. Im Durchschnitt wechselt praktisch jeden Tag (alle 1,1 Tage) ein neuer Kunde mit mehr als 250.000 Euro zu direktanlage.at. Fast jeden dritten Tag kann sich die Bank über einen neuen Kunden mit über einer halben Million Euro freuen.
Neben dem Kerngeschäft Discount Brokerage entwickelt sich auch die Vermögensverwaltung ausgezeichnet. Diese wird ab einem Anlagevolumen von 50.000 Euro angeboten. Huber: "Ich freue mich sehr, da dieser Bereich bei uns deutlich stärker wächst als beim Mitbewerb."
Jeden Tag wird ein Neukunde verzeichnet, der die professionelle Vermögensverwaltung durch die Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG nutzt. Das renommierte deutsche Unternehmen ist seit mehr als einem Jahr als Partner von direktanlage.at tätig.
bluhmberg - 27. Nov, 15:55
Es berichtete DIE ZEIT am 29.06.2006:
Mit Künstlern wie Jean-Michel Basquiat, Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Andy Warhol, Anselm Kiefer, Martin Kippenberger und Gerhard Richter handelt die Hamburger Art Estate AG. Etwa 20 dieser »Blue Chips« will sie nach eigener Auskunft erworben haben – in zweistelliger Millionenhöhe. Nun ist die AG auf der Suche nach 500 bis 1000 Zeichnern für einen geschlossenen Kunstfonds. »Das ist eine fast risikolose Anlage«, sagt der Vorstand Bernd Salomon. »Ab 10000 Euro aufwärts kann man Anteile erwerben.«
In zwei Wochen will die Art Estate AG ihren Firmensitz in Hamburg beziehen. Auf 1000 Quadratmetern können die Zeichner des Fonds dann die Werke besichtigen, die ihnen in sieben bis zehn Jahren viel Rendite einbringen sollen. Lust auf die Investition soll eine rund 60-seitige Studie machen: Contemporary Art – eine Assetklasse zur Portfoliodiversifikation lautet ihr Titel, sie wurde von der Art Estate AG in Auftrag gegeben und vom F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformation erstellt. Ausgeschmückt wurde die Studie mit Künstlerporträts und Abbildungen von Werken, die jedoch nicht in allen Fällen von der Art Estate angekauft wurden. Weiter gibt es Kurven und Statistiken über die Preisentwicklung zeitgenössischer Kunst, Fotos und Zitate prominenter Kunstsammler und Berater. »Der gute Sammler sammelt mit den Augen, der schlechte mit den Ohren«, sagt dort Peter Raue, der Vorsitzende der Freunde der Neuen Nationalgalerie in Berlin. Ob der »gute Sammler« auch mittels eines Kunstfonds sammelt, dazu sagt Raue nichts.
Der Verfasser der Studie, Eric Czotscher, sagt: »Je breiter man investiert, desto kleiner ist das Risiko.« Fünf bis zehn Prozent Kunst empfiehlt er für ein Portfolio. In den USA soll sich das für Hedge-Fonds bereits eingebürgert haben. Kenner der Szene verweisen auf etwa sechs Händler, die in New York für derartig hoch spekulative Fonds Kunstwerke kaufen.
Wem genau aber vertraut der Anteilseigner des Kunstfonds bei Art Estate sein Geld an?
Die Art Estate AG ist eine hundertprozentige Tochter der EECH Group AG, ebenfalls in Hamburg ansässig und in Frankfurt an der Börse notiert. Sie investiert unter anderem in Windenergie und Immobilien. Die Art Estate AG, so Bernd Salomon, operiere auf mehreren Ebenen: Einmal sei da der Fonds für ein breites Publikum, dann der Einzelhandel mit drei Galerien namens Vonderbank in Berlin, Hamburg und Frankfurt, und der Großhandel in Kooperation mit internationalen Galerien.
Die Verflechtungen und Besitzverhältnisse sind nur schwer durchschaubar
(Zitat Ende)
Es schreibt die
FINANCIAL TIMES (D) am 03-11-2006:
Die unseriösen Anbieter dieser Produkte "fühlen sich in Sicherheit", weil die als Inhaber- oder Orderschuldverschreibungen oder auch Genussscheine eingesammelten Gelder des Publikums nach dem Kreditwesengesetz (KWG) nicht unter den Begriff des Einlagengeschäftes und somit nicht unter die Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) fallen.
So warnt das DIAS davor, dass unseriöse Vertriebsmitarbeiter Unternehmensanleihen als private Altersvorsorge anpreisen. Anleger sollten davon bessern die Finger lassen, da dieser Markt einfach nicht unter einer staatlichen Aufsicht stehe und es keine Einlagensicherung gebe.
Die EEHC ist nach der Studie eine Tochter des windkraftgebeutelten Börsenleichtgewichts P & T Technology. Nachdem das Windkraftgeschäft in Deutschland eingebrochen ist und P & T einen Verlust machte, kam die EECH vor einem Jahr mit einer 30 Mio. Euro schweren "Euro Anleihe Solar" auf den Markt. Allerdings wiesen Wirtschaftsprüfer darauf hin, dass für das Geschäftsjahr 2003 nach externer Bilanzprüfung Nachweise über ein Guthaben in der Türkei in Höhe von rund 280.000 Euro "nicht geführt werden".
Der Unternehmenschef der EECH heißt Tarik Ersin Yoleri. Dieser hat bereits eine Vergangenheit im Handel mit überteuerten vermieteten Eigentumswohnungen. Er verkaufte als Subunternehmer der "Appel Grundvermögen" im Osten und in Berlin Steuersparimmobilien. Anfang 2001 musste "Appel" mit einem riesigen Schuldenberg Insolvenz anmelden.
Seitdem ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen des "Verdachts auf Insolvenzverschleppung und Untreue".
Auch die Kunstanleihen sind fragwürdig. Die "ArtEstate"
soll nach Angaben der EECH-Group ca. 500 Werke von Top-30-Künstlern besitzen. Die Kunstwerke habe der EECH-Chef und Hauptaktionär Tarik Ersin Yoleri in den vergangenen Jahren zusammengekauft. Schuldner der Kunst-Anleihe ist die EECH-Group. Die EECH-Group weist in der Konzernbilanz Vermögenswerte von mehr als 90 Mio. Euro aus. Ein entsprechendes Eigenkapital sucht man in der Bilanz jedoch vergeblich. Lediglich die Konzernmutter EECH AG weist in der Bilanz ein bescheidenes Eigenkapital von gerade einmal 4,8 Mio. Euro aus.
via
bluhmberg - 26. Nov, 16:20
Täglich erinnern Blogs und Foto-Communities die klassischen Medien daran, dass sie kein so richtiges Monopol mehr auf Nachrichtenvermittlung haben. Kein Wunder, dass manche Verlage die schmerzhafte Erkenntnis in eine neue Strategie umzumünzen versuchen. Blogger meinen, dass auch die Redakteure umdenken müssten: Der Deutsche Journalistenverband verschließe mit seinem Protest gegen "Leser-Reporter" die Augen davor, "dass sich der Berufsstand Journalismus gerade in einem fundamentalen Umbruch befindet", kritisierte Roland Grün. "Die ,Berichterstattung aus dem Wohnzimmer' ist unweigerlich auf dem Vormarsch, ob nun mit oder ohne Zeitungen." Auch künftig seien Journalisten mit ihren Fähigkeiten gefragt - jedoch in einer Vermittler- oder Moderatorenrolle.
Privatsphäre war gestern, sagen die Kritiker, vor allem Anwälte von Prominenten und Journalisten. Sie haben recht. Doch sie heucheln.
Denn es macht sich inzwischen jeder das ganze Bild, überall und immerfort, vor allem im Internet, ob bei MySpace oder YouTube. Mit dem Handy ruft man nicht zuerst den Notarzt, die Feuerwehr oder die Polizei, sondern macht ein Foto und stellt es ins Netz. Schießen professionelle Fotografen ein Bild mit Prominenten und Masse, ist garantiert einer in Sicht, der gerade sein Handy hochhält, um zu knipsen. Seht her, ich bin dabei, ich bin mittendrin, ich bin ganz nah dran. Wer fotografiert, begeht nicht Selbstmord, hat der französische Soziologe Pierre Bourdieu einmal gesagt. Wer fotografiert, der hält sein Leben und den Augenblick fest, der verweilen soll. Und doch stellen uns die „Leserreporter“ nach - und entlarven uns zugleich als die Voyeure, die wir sind.
Sie sind da, bevor die Fotografen der Nachrichtenagenturen auftauchen. Sie zeigen Autos, die brennen, und nicht erst die Löscharbeiten der Feuerwehr. Das macht sie für den Journalismus so interessant, ja unentbehrlich. „Mit den Leserreportern überwinden wir Zeit und Raum“, sagt der „Bild“-Chefredakteur Kai Diekmann. Und weil das so ist, hat sein Blatt inzwischen etwa 1100 Bilder von Leserreportern gedruckt. Mehr als 249.000 Euro an Honoraren sind geflossen. Für jeden Schnappschuß gibt es zwischen hundert und fünfhundert Euro. Drei Klagen von Prominenten sind eingegangen, alle vom selben Anwalt. Ganze Seiten füllen die Leser-Bilder inzwischen, sie machen Nachrichten. Zwanzigtausend Bilder von Lesern hat die Redaktion gebunkert, täglich werden es tausend mehr; im Sommer waren es bis zu 2500. Nur die wenigsten zeigen Prominente in peinlichen Posen.
Doch nicht nur der Boulevard hat die Bedeutung der Leser als Fotografen entdeckt - von der „Bild“ in Hamburg bis zur „tz“ in München. Angefangen hat die „Saarbrücker Zeitung“ damit. Sie ist dem Vorbild des norwegischen Boulevardblatts „VG“ gefolgt, das mit Fotos vom Tsunami Aufsehen erregte. Der „Stern“ hat den Lesern mit „Augenzeugen.de“ ein Portal eingerichtet und festgestellt: „Gute Pressefotos werden immer öfter von Amateuren gemacht. Mit Kleinkameras oder Knips-Handys sind sie oft schneller als Profi-Fotografen.“ Nachrichtenwert sollten die Bilder haben, schreibt der „Stern“ zu seinem Portal und sagt: „keine Chance für Möchtegern-Paparazzi“. Doch was hat Nachrichtenwert? „Gesucht wird alles, was Chancen hat, veröffentlicht zu werden: Bilder von Naturereignissen etwa, von Prominenten, von Sportereignissen, Naturkatastrophen und Unfällen.“
Und so sieht das dann aus: tödlicher Verkehrsunfall auf der A7 zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim-West (4. November, 4.55 Uhr), ein verkohlter Schuh neben einem Auto. In Göttingen muß sich ein junger Mann, dessen Gesicht nur halbherzig unkenntlich gemacht worden ist, einer Alkoholkontrolle stellen (4. September, 13 Uhr). Ein verwundeter Kfor-Soldat wird nach einem Minenunfall im Flugzeug nach Deutschland transportiert (keine Orts- und Zeitangabe). Angela Merkel und Wladimir Putin mit grimmiger Miene in Dresden beim Petersburger Dialog. Kardinal Lehmann gähnt in Mainz.
Bei augenzeuge.de können Leserreporter mit ihren Bildern noch mehr Geld verdienen als bei „Bild“. Die Profis stellen sie regelrecht ein. Die Aufnahmen werden von der Agentur Picture Press, die wie der „Stern“ zu Gruner + Jahr gehört, vermarktet. Ein Bild, das in die Zeitung kommt, bringt, je nach Auflage, 45 bis hundert Euro, landet es auf dem Titel einer Illustrierten mit Millionenauflage, steht ein Honorar von 820 Euro ins Haus.
Die Bilder von Lesern lohnen sich also, für beide Seiten, sie werden professionell eingebunden, was die journalistische Erregung über die Amateure als Heuchelei ausweist. Was die Leitartikler verdammen, kaufen die Fotochefs ein. Sogar beim Fernsehen werden die Bilder eingeworben. Während des Papst-Besuchs forderte das ZDF sein Publikum im Internet auf, dazu die schönsten Bilder einzusenden - ein solches wie von dem unbekannten „Bild“-Leser war freilich nicht dabei. Und bei dem Nachrichtensender CNN geht längst nichts mehr ohne die „Citizen Reporter“. Das war zuletzt bei den Bombenanschlägen auf die U-Bahn in Bombay zu sehen, als den ganzen Tag Videoeinspielungen von Zuschauern liefen; ein Laufband forderte auf, für Nachschub zu sorgen. Bei N24 gibt es die „Augenzeugen“ schon seit einem Jahr.
Damit wirklich niemand auf den Nachschub verzichten muß, hat sich eine Tochterfirma der Deutschen Presse-Agentur, die dpa-Infocom, die 2005 die Mobilplattform „Minds“ gestartet hat, welche inzwischen rund fünfzig Regionalzeitungen nutzen, etwas einfallen lasse: man kann Schnappschüsse vom Fotohandy als Bilddatei in die Redaktion senden. Big Brother is watching you.
Zum Fürchten sind die Leserreporter dennoch. Denn die Hemmschwelle, Menschen gerade in unpassendsten Gelegenheiten festzuhalten, sinkt erheblich, wenn Zeitungen einen anstacheln und es auch noch Geld dafür gibt, andere bloßzustellen. Nicht ohne Grund gibt es inzwischen Dienstanweisungen für Rettungssanitäter und Feuerwehrleute, doch bitte ihren Job zu tun und nicht erst an ein Foto zu denken. Doch vor allem dem gemeinen Blockwart von nebenan ergeben sich ganz neue Möglichkeiten: ein Polizist ohne Helm auf dem Moped, ein anderer mit Handy im Auto, ein Hundebesitzer, der seinen Vierbeiner mit dem Hochdruckreiniger duscht. Sie alle werden ertappt und, im engeren sozialen Kreis, erkannt und lächerlich gemacht. Nachrichtenwert haben solche Bilder nicht. In der Zeitung landen sie trotzdem. Dabei könnten sich die Abgebildeten wehren, denn verletzt wird, so sie zu erkennen sind, ihr Recht am eigenen Bild. Die Leserreporter jedoch haben in der Regel wenig zu befürchten, Redaktion und Verlag müssen für ihre Fotos genauso geradestehen wie für die der Berufsfotografen.
Doch ist auch anderen Leserreportern, die mit Lack und Leder oder Latex nichts am Hut haben, nach dem Bild unter Umständen nicht mehr so wohl. Der Chefredakteur der dpa, Wilm Herlyn, der sich einmal privat als „Bild“-Leserreporter betätigte, sagt, er würde es nicht wieder machen. Aus einer „Urlaubslaune“ heraus hatte er seinen Freund, Fernsehmoderator Heiner Bremer, badehosennackig am Strand fotografiert. Das fällige Honorar spendete Herlyn für einen guten Zweck. Professionell sagt er zu Leserreportern für seine Agentur ein klares „nein“.
bluhmberg - 26. Nov, 16:09
Österreichs prominentester Anlegerschützer, "Hauptversammlungsschreck" und IVA - Chef Wilhelm Rasinger, hat in wochenlanger Kleinarbeit ein umfangreiches Dossier über den österreichischen Finanzjongleur und Geschäftsmann Mirko "Winner" Kovats zusammengetragen. Das Ergebnis: Die derzeit in vielen Medien massiv beworbene Aktie des Bilanzakrobaten ist offenbar wenig empfehlenswert.
Der Interessenverband für Anleger (IVA) hat den Emissionsprospekt
der österreichischen A-Tec Industries unter die Lupe genommen und übt heftige Kritik an der Informationspolitik des Mischkonzerns, der dem heimischen Industriellen und Finanzjongleur Mirko "Winner" Kovats gehört. "Die derzeit laufende Zeichnungsfrist für A-Tec-Industries-Aktien unterstreicht einmal mehr die Notwendigkeit, die Rechtsvorschriften für Kapitalmarktprospekte zu ändern", betonte IVA-Präsident Wilhelm Rasinger. Konkret stößt sich der Kleinaktionärsvertreter etwa an der niedrigen Eigenkaptialquote von nur 11,1 Prozent.
"Für einen Börsengang, bei dem durch intensive Werbung der österreichische Privatanleger angesprochen wird, müssen die Vorschriften zum Zugang der Informationen vom Gesetzgeber verbessert werden. Die A-Tec-Aktie näher in Betracht ziehen sollte nur, wer Wirtschaftsenglisch sehr gut beherrscht und demnach die Risikohinweise richtig interpretieren kann", warnt Rasinger.
Bei der Analyse des A-Tec-Emissionsprospektes ist der Anlegerverband auf eine Reihe von Kritikpunkten gestoßen: Der Eigenkapitalanteil der A-Tec habe sich per 30. September 2006 auf nur auf 11,1 Prozent belaufen - "ein sehr niedriger Wert im Branchenvergleich", so der IVA. Das Eigenkapital ohne Fremdanteile beträgt 148 Mio. Euro.
Im Emissionsprospekt findet sich auch die Darstellung umfangreicher Transaktionen der A-Tec mit der M.U.S.T-Stiftung, die Kovats gehört. Diese Transaktionen haben das Eigenkapital der A-Tec laut Aktionärsvertreter "in einer schwierigen finanziellen Situation wesentlich geschwächt". Nach erfolgreichem Börsegang, bei dem Kovats rund 230 Mio. Euro erlösen will, ...
... werden über 100 Mio. Euro an Liquidität und Vermögenswerte hinter die "Fire wall" seiner Privatstiftung transferiert, also letztlich in Mirkos Privatschatulle verschoben. "Ob dies von Privatanlegern verstanden und goutiert wird, bleibt dahingestellt", formuliert Rasinger extrem vorsichtig, um Millionenklagen des Finanzjongleurs vorzubeugen.
Die immateriellen Vermögenswerte belaufen sich allein auf 233 Mio. Euro - davon 163 Mio. Euro "Good Will" aus Firmenakquisitionen. Geringere Umsätze bzw. geringere Cash Flows als erwartet sowie Änderungen der Diskontrate könnten eine wesentliche Belastung (Firmenwertabschreibung) erfordern, die sich reduzierend auf das Eigenkapital durchschlagen.
Mit Ausnahme des geprüften Jahresabschlusses für die börsenotierte steirische ATB Antriebstechnik AG, die zu 86 Prozent im Eigentum der A-Tec steht, seien die auf der A-Tec-Homepage veröffentlichten Zahlen (noch) nicht mit einem Prüfungsvermerk des Abschlussprüfers erhärtet, bemerkt Rasinger.
Dies sei insofern von Bedeutung, weil es im Vergleich zu 2004 in einigen wichtigen Positionen, die sich auf den Gewinn und das Eigenkapital der Gesellschaften und des Konzerns auswirken, zu wesentlichen Veränderungen gekommen sei. Auch "geprüfte Ganzjahreszahlen 2006 wären für einen Börsegang eine bessere Grundlage", meint Rasinger.
Der Verkauf der Emco-Beteiligung durch die Kovats-Stiftung MUST, die 79,5 Prozent an der A-Tec hält, an die A-Tec entzieht dem Konzern "dringend benötigte Liquidität" und stärkt im selben Ausmaß die Liquidität der Stiftung.
bluhmberg - 24. Nov, 22:56
Gegen den einst als Retter des SK Sturm Graz gefeierten Hannes Kartnig gibt es laut der "
Kleinen Zeitung" schwere Vorwürfe seitens der Grazer Finanzstrafbehörde. Er soll "offenbar keinen Unterschied" zwischen privaten Verbindlichkeiten, seiner Grazer Firma
Perspektiven und dem Fußball-Verein gemacht und die Begleichung privater Spielschulden als Zahlungen an den SK Sturm deklariert haben.
Kartnig sprach in der ORF-"Zeit im Bild" um 13.00 Uhr von einer "reinen Intrige von Finanzbeamten, die mich fertig machen wollen. Es ist eine Gemeinheit, solche Dinge zu verbreiten." Auch seine
Rechstanwälte wiesen die in der Zeitung unter Berufung auf einen seit 9. Oktober vorliegenden Zwischenbericht der Finanzstrafbehörde Graz über die Jahre 1998 bis 2001 veröffentlichten Vorwürfe entschieden zurück.
Laut der "Kleinen Zeitung" meint der behördliche Ermittlungsleiter Dietmar Schwarzl, die Erhebungen würden sich schwierig gestalten, da es zu einer "enormen Vermischung der Tätigkeiten und Vorgänge innerhalb der Firma Perspektiven und des SK Sturm Graz gekommen ist".
Die Zeitung berichtete weiter, eine Kontrolle beim SK Sturm habe es praktisch nicht gegeben. Auf Grund von Zeugenaussagen könne davon ausgegangen werden, dass Kartnig Machthaber des Fußball-Vereins war und ihn "als Teil seines Unternehmens, nämlich der Firma Perspektiven, geführt hat. Entscheidungen wurden fast ausschließlich von ihm im Alleingang getroffen", hieß es.
bluhmberg - 23. Nov, 15:28
Das beweist ein Artikel in der Stiftung Warentest, der sich bereits am 19. April 2005 intensiv mit einer anderen Direktanleihe des Graumarktanbieters EECH-Group befaßte ...
mehrbluhmberg - 23. Nov, 14:39
stimmt die Rolls-Royce-Geschichte oder ist sie frei erfunden? Wer ist Reiner Fakeman wirklich? Hatte Reiner Fakeman mit dem Blogger Hanno Hartensteyn Kontakt oder ist auch das eine Erfindung der jetzt laufenden Fake- und Verwirrspielkomödie? ...
mehrbluhmberg - 23. Nov, 14:35
Na bitte.
Am Montag soll entschieden sein, mit welchen Kaufinteressenten der BAWAG-Verkäufer Gewerkschaftsbund (ÖGB) final verhandeln wird. Allgemein wird eine Reihung der in die Endrunde gekommenen Bieter in einer "Shortlist" erwartet. Bis Weihnachten soll der Bankverkauf unter Dach und Fach sein. Von den Kaufinteressenten, allen voran von US-Investoren, die ja als Favoriten gelten, wird auf die Lösung offener Haftungsfragen gepocht, die den endgültigen Preis für die Bank noch entscheidend beeinflussen könnten. Führende Gewerkschaftsvertreter, wie etwa FSG-Chef Wilhelm Haberzettl, wiederum pochen auf Jobgarantien beim Eigentümerwechsel in der fünftgrößten Bank Österreichs.
Dass der US-Investmentfonds Cerberus als der aussichtsreicheste Kandidat für den Kauf gilt, nennt Haberzettl in den "Oberösterreichischen Nachrichten" für "rein ideologisch betrachtet: eine Katastrophe". Dennoch hält er fest, dass Cerberus keine "klassische Heuschrecke" sei.
In diesem Fall gar nicht so unrichtig. Dass Cerberus die BAWAG kriegen wird, das prophezeiten
wirkliche Banken- und Finanzinsider lustigerweise schon lange vor den Tageszeitungen.
Am kommenden Dienstag Nachmittag treten die Aufsichtsräte der vor dem Verkauf stehenden Gewerkschaftsbank BAWAG P.S.K. zusammen. In dieser brisanten Phase im Bankverkaufsprozess ist zu den aktuellen Themen auch ein Bericht über den Stand der Dinge zum Verkaufsverfahren zu erwarten.
bluhmberg - 19. Nov, 10:08
Amerikanische Kläger fordern von der Bundesrepublik Deutschland nun offenbar doch die Bedienung von Goldanleihen aus den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts mit Zins und Zinseszins. Das jedenfalls hat Kaveh Moussavi, ein Rechtsanwalt und „Research Fellow“ an der Universität Oxford, angekündigt. Aus deutschen Archiven neu zutage geförderte Dokumente belegten die Ansprüche der Anleihehalter, behauptet Moussavi, der einer der Rechtsvertreter der Kläger ist.
Im Juni dieses Jahres hatten die Kläger eine Sammelklage in Sachen Goldanleihen vor einem Gericht in Florida zurückgezogen. Damit schien diese Angelegenheit, in der gegen deutsche Institutionen und Unternehmen rufschädigende Vorwürfe samt Geldforderungen in Höhe von rund 10 Milliarden Dollar erhoben worden waren, sang- und klanglos beendet. Doch die Kläger unternehmen mit neuen Anwälten und neuen Argumenten einen neuen Anlauf. Laut Moussavi belaufen sich die Forderungen nun auf 57 Milliarden Dollar - und könnten noch steigen, da sich immer mehr Anleihehalter bei ihm meldeten. Zu den Klägern zählten auch Opfer und Hinterbliebene des Holocaust.
bluhmberg - 18. Nov, 00:53